Der Sturm
Schauspielhaus
Dauer – ca. 1:45 Std., keine Pause
Premiere
Sa – 22. Apr 23
Sa – 22. Apr 23
Mit einem großen Sturm beginnt Shakespeares letztes Drama. Himmel und Meer spielen verrückt. Eine kleine Insel rettet den Schiffbrüchigen das Leben. Es ist nicht irgendeine Insel. Der Zauberer Prospero hat sie in der Hand. Der Sturm ist die Geschichte Prosperos. Einst war er Herzog von Mailand. Zu spät bemerkte er, dass sein Bruder Antonio eine Verschwörung plante, um ihn zu stürzen und die alleinige Macht über Mailand zu erlangen. Die Intrige ging auf. Vertrieben vom königlichen Hof, wurde Prospero mit seiner Tochter Miranda auf einer Insel ausgesetzt, die er sich zu eigen machte. Zwölf Jahre lebten sie dort gemeinsam mit Caliban, ihrem Sklaven, einem Ureinwohner der Insel, und dem Luftgeist Ariel.
Eine günstige Gelegenheit verhilft Prospero nun zur Rache an seinem Bruder. Mithilfe Ariels gelingt es ihm, das vorbeiziehende Schiff mit seinen Feinden an Bord durch einen Sturm vom Kurs abzubringen und auf der Insel stranden zu lassen. Dort werden die Schiffbrüchigen Alonso, König von Neapel mit seinem Gefolge, sein Sohn Ferdinand und Antonio getrennt. Auf der fremden Insel irren sie nun umher, werden von Geistern und seltsamen Wesen verfolgt und glauben einander tot. Ferdinand aber verliebt sich, wie könnte es anders sein, in Miranda, gefolgt von einer feierlichen Verlobung … denn auch das ist Teil des Plans – der Inszenierung Prosperos und seines Luftgeists Ariel: „Lass sie ordentlich gehetzt werden. Jetzt ist die Stunde da, in der mir sämtliche meiner Feinde ausgeliefert sind. In Kürze sind all meine Mühen vollbracht, und du sollst die Luft der Freiheit atmen.“
William Shakespeares (1564–1616) visionäre Komödie Der Sturm ist sein letztes und poetischstes Werk und bietet Raum für unzählige Interpretationen und Deutungen. Mit seinem Alter Ego Prospero nimmt Shakespeare gleichsam Abschied von der Bühne. Der Sturm ist fantastisch-dystopisches Märchen, Politparabel, Rachedrama, romantische Liebesgeschichte, philosophisches Traktat und metaphysisches Metamorphosegedicht zugleich. Es erzählt vom Spannungsverhältnis zwischen Natur und Zivilisation, von den Grundlagen gerechter Herrschaft, von Selbstdisziplin und Sublimation, Verzicht und Konkurrenz. Letztlich ist und bleibt dieses Shakespeare-Drama ein offener, widersprüchlicher Text, der keine eindeutige Zuschreibung zulässt, mehr noch, sich dieser vielleicht sogar bewusst entzieht.
Eine günstige Gelegenheit verhilft Prospero nun zur Rache an seinem Bruder. Mithilfe Ariels gelingt es ihm, das vorbeiziehende Schiff mit seinen Feinden an Bord durch einen Sturm vom Kurs abzubringen und auf der Insel stranden zu lassen. Dort werden die Schiffbrüchigen Alonso, König von Neapel mit seinem Gefolge, sein Sohn Ferdinand und Antonio getrennt. Auf der fremden Insel irren sie nun umher, werden von Geistern und seltsamen Wesen verfolgt und glauben einander tot. Ferdinand aber verliebt sich, wie könnte es anders sein, in Miranda, gefolgt von einer feierlichen Verlobung … denn auch das ist Teil des Plans – der Inszenierung Prosperos und seines Luftgeists Ariel: „Lass sie ordentlich gehetzt werden. Jetzt ist die Stunde da, in der mir sämtliche meiner Feinde ausgeliefert sind. In Kürze sind all meine Mühen vollbracht, und du sollst die Luft der Freiheit atmen.“
William Shakespeares (1564–1616) visionäre Komödie Der Sturm ist sein letztes und poetischstes Werk und bietet Raum für unzählige Interpretationen und Deutungen. Mit seinem Alter Ego Prospero nimmt Shakespeare gleichsam Abschied von der Bühne. Der Sturm ist fantastisch-dystopisches Märchen, Politparabel, Rachedrama, romantische Liebesgeschichte, philosophisches Traktat und metaphysisches Metamorphosegedicht zugleich. Es erzählt vom Spannungsverhältnis zwischen Natur und Zivilisation, von den Grundlagen gerechter Herrschaft, von Selbstdisziplin und Sublimation, Verzicht und Konkurrenz. Letztlich ist und bleibt dieses Shakespeare-Drama ein offener, widersprüchlicher Text, der keine eindeutige Zuschreibung zulässt, mehr noch, sich dieser vielleicht sogar bewusst entzieht.
Inszenierung
Bühne
Kostüme
Musik
Licht
Choreografie
Dramaturgie
„Der Applaus regt mich nicht mehr so auf“
André Jung, 69, wurde in Luxemburg geboren und lebt in München. Die Frage, in welcher Sprache er träumt, konnte er nicht zweifelsfrei beantworten.
André Jung steht seit sechzig Jahren auf der Bühne. Und spielt nun Prospero, mit dem Shakespeare sich sein Alter Ego geschaffen hat. Was lernt man auf der Bühne über die Welt? Ein Gespräch über Macht, Magie und Als-ob
Interview: Sarah-Maria Deckert, Chefredakteurin von Reihe 5
Herr Jung, schafft es das Theater noch nach all den Jahren, Sie voll und ganz einzunehmen? Lässt es Sie, auch als Zuschauer, vergessen, dass es da draußen noch eine andere Welt gibt? Oder ist es eine Berufskrankheit, den Apparat immer mitzudenken?
Ich kann das ganz gut. Das einzige, was mich wahnsinnig stört, ist, wenn die Leute wissen, dass ich drinsitze. Ich bin am liebsten im Theater, wenn niemand weiß, dass ich da bin.
Was macht für Sie die Magie des Theaters aus?
Das ist schwer zu sagen. Schauen Sie, seit fast 60 Jahren gehe ich ins Theater und mache mir keine Gedanken, wie ich das bezeichnen würde, diesen Zauber. Ich finde toll, wenn ich in die Geschichte gezogen werde, wie bei einem guten Buch. Auch das Live-Erlebnis, die direkte Umsetzung des Stoffs. Das, was mir Angst macht, wenn ich selber da oben stehe.
Was macht Ihnen da Angst?
Es regt mich auf, das Lampenfieber. Immer noch.
Ist das besser geworden über die Jahre?
Das variiert. Manchmal ist es besser, manchmal steigert es sich über Monate und dann geht es wieder weg. Ab einem gewissen Alter ist es auch so, dass man mit dem Text nicht mehr so locker umgeht wie in jungen Jahren. Man lernt schwerer. Ich brauche heute die dreifache Zeit. Dieses Überlegen, „Wie ist der Satz?“, das ist Gift. Aber man hat natürlich Erfahrung. Und es passiert ja auch nichts. Die Zeit vergeht, ob man hängt oder nicht hängt. Irgendwann kommt der Applaus. Und dann sitzt man in der Kantine mit einem Glas Wein.
An der Wiener Burg heißt es gerade: 60 Prozent Auslastung ist das neue Ausverkauft. Müssen die Menschen das Ins-Theater-Gehen nach der Pandemie erst wieder lernen?
Ich erlebe das nicht so hart. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nicht fest im Ensemble bin. Am Anfang der Pandemie war das furchtbar. Da haben wir an den Kammerspielen Effinger gemacht. Das war so was von langweilig. Wir saßen an Tischen, weit auseinander, kamen nicht wirklich zum Spielen, haben immer so lange wie möglich gelesen und wussten alle, dass wir da nicht rauskommen. Dann lernt man auch den Text nicht. Schauspieler haben eine große Begabung zur Faulheit, ich gehöre auch dazu. Es braucht diesen Kick, zu wissen, oh, nur noch drei Wochen. Ein dreiviertel Jahr später sind wir dann doch rausgekommen und dann hat es Spaß gemacht. Man durfte sich wieder anfassen, wirklich zusammen spielen.
Shakespeares Sturm ist eine Hommage ans Theater. Ein Theater im Theater. Die Insel als fantastische Kulisse, Prospero als mächtiger Regisseur und Weltenbauer, Ariel und Caliban als Schauspieler, denen er Regieanweisungen gibt. Es ist diese Idee von der Welt als Bühne, von der Bühne als Welt. Was haben Sie auf der Bühne für die Welt gelernt?
Ehrlich gesagt, darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Wie man auf Rollen und auf Beziehungen schaut, das nimmt man mit ins tägliche Leben. Auf der Bühne passieren Tragödien und es geschehen Wunder, Schönes und Schreckliches, das ist kein Geheimnis. Und dann sagt man: Das ist wie im Leben. Und das ist es auch. Die Herausforderung ist, sich zu fragen: Nimmt man das jetzt so oder tut man nur so?
Ertappen Sie sich manchmal beim Nur-so-tun?
Im Leben? Nein. Im Gegenteil. Ich habe keine Lust im Leben zu spielen. Es fällt mir schwer, so zu tun, als würde ich mich freuen. Ich meide auch Feste inzwischen.
Warum?
Das regt mich nicht mehr auf. Die Zeit ist vorbei. Der Erfolg im Sinne von Applaus regt mich auch nicht mehr so auf.
Im berühmten Epilog bittet Prospero das Publikum, ihn durch Applaus zu erlösen. Da heißt es: „Wenn nicht des Beifalls Wind meine Segel bläht / war all mein Streben vergebens / euch zu gefallen.“ Ist Ihnen der Beifall, diese Anerkennung nicht mehr wichtig?
Schon wichtig. Ich freue mich wahnsinnig, wenn etwas, was ich selber gut finde, ankommt. Aber es ist jetzt nicht mehr dieses: Boah, wie kam das jetzt an?! Ich schätze die eigene Arbeit auch realistischer ein. Natürlich will ich gefallen, aber ich sehe auch, was nicht gut ist, und schaue, was ist zu verbessern. Es gibt immer schlechte Aufführungen, das ist mir sehr bewusst. Und auch schlechte Regisseure.
Wenn Sie nicht mehr auf Feste gehen, was machen Sie dann?
Ich gehe später. (Lacht) Was ich meine: In dieser Gesellschaft, in unserem Club, da will man gesehen werden, Komplimente kriegen. Und dazu habe ich mittlerweile eine gesunde Distanz. Ich koche gerne und trinke guten Wein. Aber das kann man auch nicht dauernd machen.
Shakespeare hat sich mit Prospero sein Alter Ego geschaffen. Was können Sie mit der Figur anfangen?
Ich weiß nicht, ob er sympathisch ist oder doch ein Kotzbrocken, ob er Machtbesessen ist oder ob man so wird, wenn man Herzog von Mailand war. Das interessiert mich, das rattert, das macht mich skeptisch. Vor allem auch Miranda, seine Tochter. Die ist schon so lange auf der Insel und weiß eigentlich nichts. Ist sie naiv oder zu blöd? Oder ist Prospero übergriffig, weil er sie so lässt und dann über sie nach der Macht greift? Oder wie steht man zu Ariel? Prospero liebt ihn, weil er ein toller Schauspieler ist. In Ariel sieht er das, was er nicht kann. Darum ist Prospero ja auch Regisseur. Aber keine Ahnung, wie Kosminski (Regisseur, Anm. d. Red.) das aufführen will. Ich hoffe richtig.
Gibt es richtig?
Ja natürlich. Es gibt auch falsch.
Können Sie versuchen, das Falsche zu erklären?
Ich habe gestern Abend einen Film gesehen, Prosperos Bücher von Peter Greenaway. Das ist ein Scheißdreck. Das war so furchtbar, ein Kunstgewerbe sondergleichen, eitel, und der hat Auszeichnungen bekommen noch und nöcher. Diese Pannen muss man vermeiden. Es ist auch zu Shakespeares Zeiten anders gespielt worden. Man muss seinen eigenen Prospero finden. Das Interessante an ihm ist: Er glaubt an den Zauber. Er hat ihn nicht, aber er hat das Wissen darüber. Und Caliban ist im Gegensatz zu Ariel nicht bereit, sich belehren zu lassen. Diesen Geschichten will ich nachgehen: Wie beleidigt mich das, wenn ich jemandem etwas beibringen will, und der will einfach nicht. Das macht mich doch sauer auf den! Das ist die Ohnmacht des Regisseurs. Im Stück gibt es sehr viel Antiquiertes. Das ist nicht schlecht, aber es ist aus der Zeit. Und man muss gucken: Wie ist es in meiner Zeit? Alles, was weggeht vom heutigen Empfinden, ist nicht gut. Mit diesem theatralen Getue kann ich wenig anfangen.
Können Sie mit dem Begriff Macht etwas anfangen?
„Was macht Macht?“, „Wie macht man es richtig?“, „Macht nichts.“ – Ja klar, mit dem Begriff kann ich sehr viel anfangen, mit dem Machen, mit Machtsystemen. In der Politik und im Theater. Es gibt beide Welten. Und beide sind gleich korrupt. Ich bin lange genug am Theater, um das zu wissen. Es ist eines der letzten heißen Machtzentren. Macht ist überall, es geht immer nur darum. Man braucht nur zwei Menschen zusammenzusetzen und sie über einen gewissen Zeitraum zu beobachten. Dagegen setzt man dann die Liebe. Aber auch da geht es am Ende um Macht. Das Schöne am Theater wie auch am Film ist die Idee, dass man Sachen anders beleuchten kann. Man kann anders darauf schauen.
Wie schauen Sie darauf, dass Prospero seine Macht abgibt? Er zerbricht am Ende seinen Zauberstab, vergräbt ihn und ertränkt seine Bücher. Ist das ein Akt innerer Größe? Läuterung?
Gandhi hat Macht abgegeben, Jesus auch, als er für die Menschen gestorben ist. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber in der Bibel gibt es sehr viel, was ich unterschreiben würde. Es gibt genug Beispiele dafür, dass das Streben der Menschen dahin geht, Macht nicht zu missbrauchen. Macht hat man immer und das ist nicht per se was Schlechtes. Wenn man Kinder hat, macht man alles für sie. Man muss ihnen aber auch zeigen, wie es geht.
Haben Sie sich auch mal ohnmächtig gefühlt?
Ja, klar. Oft. Immer noch. Aber es stört mich nicht groß. Sich in bestimmten Situationen ohnmächtig fühlen, ist einfach scheiße. Sich generell ohnmächtig fühlen, ist eine Tatsache. Wir sind ohnmächtig.
Und dann geht es nur noch darum, das auszuhalten?
Nein, das wäre ja Leiden. Wir müssen vorangehen. Die wirkliche Ohnmacht käme, wenn wir wüssten, wir sind unsterblich. Das wäre furchtbar.
Und doch gibt es so viele, die danach streben.
Vielleicht eher danach, in Erinnerung zu bleiben.
Wie möchten Sie in Erinnerung bleiben?
Daran arbeite ich nicht. Aber doch: im Guten. Man kommt rüber mit dem, was man tut. Und das ist nicht interpretierbar. Man ist ein Teil des Ganzen. Und für diesen Dialog ist Theater die richtigste Kunst.
Wer hat im Theater eigentlich die Macht? Wer ist da der wahre Magier, der alles verwandelt und irgendwann zurückverwandelt? Der Schauspieler, der Regisseur oder am Ende doch das Publikum?
Ich tendiere dazu, zu sagen, der Schauspieler oder die Schauspielerin. Die besitzen eine subversive Form von Macht. Weil man reagieren, Dinge zurechtbiegen kann, während man noch in der Arbeit ist.
Worauf achten Sie, wenn Sie spielen, damit der Zauber wirkt?
Konzentration auf den Stoff. Wie ein Skiläufer, der jeden Schwung kontrolliert. So geht man vor jeder Aufführung die Situationen nochmal durch, Punkte, die man nicht verpassen darf, um sie abzuspeichern. Dann kann man richtig loslegen und muss nicht während dem Spielen daran denken. Davor eine Banane, die gibt Kraft für den Moment. Und Wasser schütte ich rein, auch wenn ich keinen Durst habe, damit der Tank gefüllt ist.
Sie sprachen es vorhin an: Im Stück versucht Prospero dem aufbegehrenden Caliban zu lehren, was in jeder Schauspielausbildung ganz oben steht: das Sprechen. Caliban ist das egal. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Sprache?
Die ist mir nicht wichtig. Aus dem einfachen Grund: Weil ich das mit anderen Sachen verbinde. Sprache hat etwas mit Stimme zu tun, und die mit Stimmung. Wenn die Situation stimmt, dann sitzt auch die Stimme. Wenn der Gedanke stimmt, dann stimmt die Sprache. Im besten Falle stellt man nichts her. Einen Satz richtig zu sprechen, ist der pure Gedanke, so wie: „Mir reicht’s!“ Wenn man das wirklich meint, stimmt es.
Gibt es Regie-Lektionen, die Sie nie kapiert haben?
Einige. Im guten Sinne. Oft habe ich sie nicht angenommen, weil ich es nicht genug verstanden habe. Werner Düggelin (prägender Regisseur Jungs früher Jahre, Anm. d. Red.) bin ich manchmal ausgewichen, weil es mir zu kompliziert wurde. Daran halte ich mich heute noch.
An was halten Sie sich?
Alles Überflüssige weg. Übergangslos die Sachen spielen und nicht verbrämen. Man kann verbrämen, dann ist es aber anders gemeint. In Komödien zum Beispiel. Man soll nicht drei Runden drehen müssen, bevor man weinen kann. Dann soll man lieber nicht weinen. Man soll immer nur das spielen, was man kann. Das hat mir zumindest Werner Düggelin versucht, beizubringen.
Was wollten Sie Ihren Kindern unbedingt beibringen?
Optimismus. Und Freue. Ich bin optimistisch im Großen und Ganzen.
Eine Tugend heutzutage.
Ja. Man muss gucken, was realistisch und was möglich ist. Und was besser ist. Besser ist es, froh zu sein, als deprimiert. Es gibt genug, über das man sich freuen kann.
Ihr Schauspiel ist subtil, leise, zart. Eher Understatement als Überstatement. Damit unterlaufen Sie vielleicht sogar die Erwartungen an einen großsprecherischen Prospero. Ist jetzt, mit knapp 70, ein guter Zeitpunkt, ihn zu spielen? Oder wäre das früher auch schon gegangen?
Nein, ich glaube nicht. Für die meisten Rollen muss man das richtige Alter haben. Auch umgekehrt. Ich glaube nicht, dass ich heute Romeo spielen könnte. Da würde ich mich schämen. Ich könnte das nicht mehr nachvollziehen. Und dann kann man es nur noch verarschen. Ich könnte ihn andersherum so beobachten, wie ich ein Tier beobachte, und das dann als Studie wiedergeben. Aber das würde mir keinen Spaß machen. Das soll jemand spielen, der in dem Saft ist, der die Verirrungen noch kennt.
Gab es Rollen, bei denen Sie fehlbesetzt waren?
Ja, der Lear. Ich habe das auch gefühlt und zum Ausdruck gebracht. Das war zu früh. Das ist auch keine Katastrophe, aber die Rolle möchte ich nie mehr spielen, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben.
Und wann ist das eigene Spiel magisch?
Wenn man es schafft, sich in einen Zustand zu versetzen, in dem man Sachen hinkriegt, die man sonst nicht hinkriegen würde. Wie was Drogen mit einem machen, aber ohne fremde Zuwirkung. Man löst aus seinem Körper Kräfte, von denen man nicht weiß, dass sie in einem drin stecken. Das Spiel über die Imagination, das Reingehen, auch im Zusammenspiel mit anderen Menschen.
Das hat dann sicher viel mit Sympathien und Antipathien zu tun.
So ist es. Bei Antipathie gelingt es einem selten, die zu überspielen. Bei meiner letzten Arbeit, Thorsten Lensings Verrückt nach Trost, habe ich mit einer Truppe gespielt, in der sich alle gerne mögen, da spielt man bis die Schwarte kracht. Man geht auch manchmal drüber, das macht dann enormen Spaß. Weil man im Bewusstsein hat, dass das etwas ganz Besonderes ist. Einfach spielen und sich dabei gut zu fühlen, das macht ja niemand mehr. Kinder tun das. Und Affen. Bei Erwachsenen kostet das Überwindung. Und es braucht Vertrauen.
Haben Sie noch Angst davor, sich lächerlich zu machen?
Nein, keine Angst. Im Grunde ist ja auch niemand lächerlich.
An einer Stelle im Stück, nachdem Prospero Miranda und Ferdinand seinen Zauber vorgeführt hat, ist die Show sprichwörtlich aus. Da heißt es sehr bekannt: „Wir sind aus demselben Stoff, aus dem auch Träume gemacht werden. Und unser kleines Leben ist vom Schlaf umzingelt.“ Alle Wolkenkratzer, Prunkpaläste und ehrwürdigen Tempel lösen sich auf, selbst der ganze Globus, wie die Geister aus Prosperos Vorstellung. Was bleibt von uns am Ende?
Da will ich nicht groß poetisch sein: Ruhe. (Überlegt lange) Es gibt da einen Satz von Beckett aus Warten auf Godot: „Sie gebären rittlings über dem Grabe, der Tag erglänzt einen Augenblick und dann von neuem die Nacht.“ Das ist seine Lebensbeschreibung. Ein unheimlich poetischer Satz, zu dem will ich gar nicht mehr sagen.
Also lieber doch poetisch zum Ende?
Ja, doch.
Ich kann das ganz gut. Das einzige, was mich wahnsinnig stört, ist, wenn die Leute wissen, dass ich drinsitze. Ich bin am liebsten im Theater, wenn niemand weiß, dass ich da bin.
Was macht für Sie die Magie des Theaters aus?
Das ist schwer zu sagen. Schauen Sie, seit fast 60 Jahren gehe ich ins Theater und mache mir keine Gedanken, wie ich das bezeichnen würde, diesen Zauber. Ich finde toll, wenn ich in die Geschichte gezogen werde, wie bei einem guten Buch. Auch das Live-Erlebnis, die direkte Umsetzung des Stoffs. Das, was mir Angst macht, wenn ich selber da oben stehe.
Was macht Ihnen da Angst?
Es regt mich auf, das Lampenfieber. Immer noch.
Ist das besser geworden über die Jahre?
Das variiert. Manchmal ist es besser, manchmal steigert es sich über Monate und dann geht es wieder weg. Ab einem gewissen Alter ist es auch so, dass man mit dem Text nicht mehr so locker umgeht wie in jungen Jahren. Man lernt schwerer. Ich brauche heute die dreifache Zeit. Dieses Überlegen, „Wie ist der Satz?“, das ist Gift. Aber man hat natürlich Erfahrung. Und es passiert ja auch nichts. Die Zeit vergeht, ob man hängt oder nicht hängt. Irgendwann kommt der Applaus. Und dann sitzt man in der Kantine mit einem Glas Wein.
An der Wiener Burg heißt es gerade: 60 Prozent Auslastung ist das neue Ausverkauft. Müssen die Menschen das Ins-Theater-Gehen nach der Pandemie erst wieder lernen?
Ich erlebe das nicht so hart. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nicht fest im Ensemble bin. Am Anfang der Pandemie war das furchtbar. Da haben wir an den Kammerspielen Effinger gemacht. Das war so was von langweilig. Wir saßen an Tischen, weit auseinander, kamen nicht wirklich zum Spielen, haben immer so lange wie möglich gelesen und wussten alle, dass wir da nicht rauskommen. Dann lernt man auch den Text nicht. Schauspieler haben eine große Begabung zur Faulheit, ich gehöre auch dazu. Es braucht diesen Kick, zu wissen, oh, nur noch drei Wochen. Ein dreiviertel Jahr später sind wir dann doch rausgekommen und dann hat es Spaß gemacht. Man durfte sich wieder anfassen, wirklich zusammen spielen.
Shakespeares Sturm ist eine Hommage ans Theater. Ein Theater im Theater. Die Insel als fantastische Kulisse, Prospero als mächtiger Regisseur und Weltenbauer, Ariel und Caliban als Schauspieler, denen er Regieanweisungen gibt. Es ist diese Idee von der Welt als Bühne, von der Bühne als Welt. Was haben Sie auf der Bühne für die Welt gelernt?
Ehrlich gesagt, darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Wie man auf Rollen und auf Beziehungen schaut, das nimmt man mit ins tägliche Leben. Auf der Bühne passieren Tragödien und es geschehen Wunder, Schönes und Schreckliches, das ist kein Geheimnis. Und dann sagt man: Das ist wie im Leben. Und das ist es auch. Die Herausforderung ist, sich zu fragen: Nimmt man das jetzt so oder tut man nur so?
Ertappen Sie sich manchmal beim Nur-so-tun?
Im Leben? Nein. Im Gegenteil. Ich habe keine Lust im Leben zu spielen. Es fällt mir schwer, so zu tun, als würde ich mich freuen. Ich meide auch Feste inzwischen.
Warum?
Das regt mich nicht mehr auf. Die Zeit ist vorbei. Der Erfolg im Sinne von Applaus regt mich auch nicht mehr so auf.
Im berühmten Epilog bittet Prospero das Publikum, ihn durch Applaus zu erlösen. Da heißt es: „Wenn nicht des Beifalls Wind meine Segel bläht / war all mein Streben vergebens / euch zu gefallen.“ Ist Ihnen der Beifall, diese Anerkennung nicht mehr wichtig?
Schon wichtig. Ich freue mich wahnsinnig, wenn etwas, was ich selber gut finde, ankommt. Aber es ist jetzt nicht mehr dieses: Boah, wie kam das jetzt an?! Ich schätze die eigene Arbeit auch realistischer ein. Natürlich will ich gefallen, aber ich sehe auch, was nicht gut ist, und schaue, was ist zu verbessern. Es gibt immer schlechte Aufführungen, das ist mir sehr bewusst. Und auch schlechte Regisseure.
Wenn Sie nicht mehr auf Feste gehen, was machen Sie dann?
Ich gehe später. (Lacht) Was ich meine: In dieser Gesellschaft, in unserem Club, da will man gesehen werden, Komplimente kriegen. Und dazu habe ich mittlerweile eine gesunde Distanz. Ich koche gerne und trinke guten Wein. Aber das kann man auch nicht dauernd machen.
Shakespeare hat sich mit Prospero sein Alter Ego geschaffen. Was können Sie mit der Figur anfangen?
Ich weiß nicht, ob er sympathisch ist oder doch ein Kotzbrocken, ob er Machtbesessen ist oder ob man so wird, wenn man Herzog von Mailand war. Das interessiert mich, das rattert, das macht mich skeptisch. Vor allem auch Miranda, seine Tochter. Die ist schon so lange auf der Insel und weiß eigentlich nichts. Ist sie naiv oder zu blöd? Oder ist Prospero übergriffig, weil er sie so lässt und dann über sie nach der Macht greift? Oder wie steht man zu Ariel? Prospero liebt ihn, weil er ein toller Schauspieler ist. In Ariel sieht er das, was er nicht kann. Darum ist Prospero ja auch Regisseur. Aber keine Ahnung, wie Kosminski (Regisseur, Anm. d. Red.) das aufführen will. Ich hoffe richtig.
Gibt es richtig?
Ja natürlich. Es gibt auch falsch.
Können Sie versuchen, das Falsche zu erklären?
Ich habe gestern Abend einen Film gesehen, Prosperos Bücher von Peter Greenaway. Das ist ein Scheißdreck. Das war so furchtbar, ein Kunstgewerbe sondergleichen, eitel, und der hat Auszeichnungen bekommen noch und nöcher. Diese Pannen muss man vermeiden. Es ist auch zu Shakespeares Zeiten anders gespielt worden. Man muss seinen eigenen Prospero finden. Das Interessante an ihm ist: Er glaubt an den Zauber. Er hat ihn nicht, aber er hat das Wissen darüber. Und Caliban ist im Gegensatz zu Ariel nicht bereit, sich belehren zu lassen. Diesen Geschichten will ich nachgehen: Wie beleidigt mich das, wenn ich jemandem etwas beibringen will, und der will einfach nicht. Das macht mich doch sauer auf den! Das ist die Ohnmacht des Regisseurs. Im Stück gibt es sehr viel Antiquiertes. Das ist nicht schlecht, aber es ist aus der Zeit. Und man muss gucken: Wie ist es in meiner Zeit? Alles, was weggeht vom heutigen Empfinden, ist nicht gut. Mit diesem theatralen Getue kann ich wenig anfangen.
Können Sie mit dem Begriff Macht etwas anfangen?
„Was macht Macht?“, „Wie macht man es richtig?“, „Macht nichts.“ – Ja klar, mit dem Begriff kann ich sehr viel anfangen, mit dem Machen, mit Machtsystemen. In der Politik und im Theater. Es gibt beide Welten. Und beide sind gleich korrupt. Ich bin lange genug am Theater, um das zu wissen. Es ist eines der letzten heißen Machtzentren. Macht ist überall, es geht immer nur darum. Man braucht nur zwei Menschen zusammenzusetzen und sie über einen gewissen Zeitraum zu beobachten. Dagegen setzt man dann die Liebe. Aber auch da geht es am Ende um Macht. Das Schöne am Theater wie auch am Film ist die Idee, dass man Sachen anders beleuchten kann. Man kann anders darauf schauen.
Wie schauen Sie darauf, dass Prospero seine Macht abgibt? Er zerbricht am Ende seinen Zauberstab, vergräbt ihn und ertränkt seine Bücher. Ist das ein Akt innerer Größe? Läuterung?
Gandhi hat Macht abgegeben, Jesus auch, als er für die Menschen gestorben ist. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber in der Bibel gibt es sehr viel, was ich unterschreiben würde. Es gibt genug Beispiele dafür, dass das Streben der Menschen dahin geht, Macht nicht zu missbrauchen. Macht hat man immer und das ist nicht per se was Schlechtes. Wenn man Kinder hat, macht man alles für sie. Man muss ihnen aber auch zeigen, wie es geht.
Haben Sie sich auch mal ohnmächtig gefühlt?
Ja, klar. Oft. Immer noch. Aber es stört mich nicht groß. Sich in bestimmten Situationen ohnmächtig fühlen, ist einfach scheiße. Sich generell ohnmächtig fühlen, ist eine Tatsache. Wir sind ohnmächtig.
Und dann geht es nur noch darum, das auszuhalten?
Nein, das wäre ja Leiden. Wir müssen vorangehen. Die wirkliche Ohnmacht käme, wenn wir wüssten, wir sind unsterblich. Das wäre furchtbar.
Und doch gibt es so viele, die danach streben.
Vielleicht eher danach, in Erinnerung zu bleiben.
Wie möchten Sie in Erinnerung bleiben?
Daran arbeite ich nicht. Aber doch: im Guten. Man kommt rüber mit dem, was man tut. Und das ist nicht interpretierbar. Man ist ein Teil des Ganzen. Und für diesen Dialog ist Theater die richtigste Kunst.
Wer hat im Theater eigentlich die Macht? Wer ist da der wahre Magier, der alles verwandelt und irgendwann zurückverwandelt? Der Schauspieler, der Regisseur oder am Ende doch das Publikum?
Ich tendiere dazu, zu sagen, der Schauspieler oder die Schauspielerin. Die besitzen eine subversive Form von Macht. Weil man reagieren, Dinge zurechtbiegen kann, während man noch in der Arbeit ist.
Worauf achten Sie, wenn Sie spielen, damit der Zauber wirkt?
Konzentration auf den Stoff. Wie ein Skiläufer, der jeden Schwung kontrolliert. So geht man vor jeder Aufführung die Situationen nochmal durch, Punkte, die man nicht verpassen darf, um sie abzuspeichern. Dann kann man richtig loslegen und muss nicht während dem Spielen daran denken. Davor eine Banane, die gibt Kraft für den Moment. Und Wasser schütte ich rein, auch wenn ich keinen Durst habe, damit der Tank gefüllt ist.
Sie sprachen es vorhin an: Im Stück versucht Prospero dem aufbegehrenden Caliban zu lehren, was in jeder Schauspielausbildung ganz oben steht: das Sprechen. Caliban ist das egal. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Sprache?
Die ist mir nicht wichtig. Aus dem einfachen Grund: Weil ich das mit anderen Sachen verbinde. Sprache hat etwas mit Stimme zu tun, und die mit Stimmung. Wenn die Situation stimmt, dann sitzt auch die Stimme. Wenn der Gedanke stimmt, dann stimmt die Sprache. Im besten Falle stellt man nichts her. Einen Satz richtig zu sprechen, ist der pure Gedanke, so wie: „Mir reicht’s!“ Wenn man das wirklich meint, stimmt es.
Gibt es Regie-Lektionen, die Sie nie kapiert haben?
Einige. Im guten Sinne. Oft habe ich sie nicht angenommen, weil ich es nicht genug verstanden habe. Werner Düggelin (prägender Regisseur Jungs früher Jahre, Anm. d. Red.) bin ich manchmal ausgewichen, weil es mir zu kompliziert wurde. Daran halte ich mich heute noch.
An was halten Sie sich?
Alles Überflüssige weg. Übergangslos die Sachen spielen und nicht verbrämen. Man kann verbrämen, dann ist es aber anders gemeint. In Komödien zum Beispiel. Man soll nicht drei Runden drehen müssen, bevor man weinen kann. Dann soll man lieber nicht weinen. Man soll immer nur das spielen, was man kann. Das hat mir zumindest Werner Düggelin versucht, beizubringen.
Was wollten Sie Ihren Kindern unbedingt beibringen?
Optimismus. Und Freue. Ich bin optimistisch im Großen und Ganzen.
Eine Tugend heutzutage.
Ja. Man muss gucken, was realistisch und was möglich ist. Und was besser ist. Besser ist es, froh zu sein, als deprimiert. Es gibt genug, über das man sich freuen kann.
Ihr Schauspiel ist subtil, leise, zart. Eher Understatement als Überstatement. Damit unterlaufen Sie vielleicht sogar die Erwartungen an einen großsprecherischen Prospero. Ist jetzt, mit knapp 70, ein guter Zeitpunkt, ihn zu spielen? Oder wäre das früher auch schon gegangen?
Nein, ich glaube nicht. Für die meisten Rollen muss man das richtige Alter haben. Auch umgekehrt. Ich glaube nicht, dass ich heute Romeo spielen könnte. Da würde ich mich schämen. Ich könnte das nicht mehr nachvollziehen. Und dann kann man es nur noch verarschen. Ich könnte ihn andersherum so beobachten, wie ich ein Tier beobachte, und das dann als Studie wiedergeben. Aber das würde mir keinen Spaß machen. Das soll jemand spielen, der in dem Saft ist, der die Verirrungen noch kennt.
Gab es Rollen, bei denen Sie fehlbesetzt waren?
Ja, der Lear. Ich habe das auch gefühlt und zum Ausdruck gebracht. Das war zu früh. Das ist auch keine Katastrophe, aber die Rolle möchte ich nie mehr spielen, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben.
Und wann ist das eigene Spiel magisch?
Wenn man es schafft, sich in einen Zustand zu versetzen, in dem man Sachen hinkriegt, die man sonst nicht hinkriegen würde. Wie was Drogen mit einem machen, aber ohne fremde Zuwirkung. Man löst aus seinem Körper Kräfte, von denen man nicht weiß, dass sie in einem drin stecken. Das Spiel über die Imagination, das Reingehen, auch im Zusammenspiel mit anderen Menschen.
Das hat dann sicher viel mit Sympathien und Antipathien zu tun.
So ist es. Bei Antipathie gelingt es einem selten, die zu überspielen. Bei meiner letzten Arbeit, Thorsten Lensings Verrückt nach Trost, habe ich mit einer Truppe gespielt, in der sich alle gerne mögen, da spielt man bis die Schwarte kracht. Man geht auch manchmal drüber, das macht dann enormen Spaß. Weil man im Bewusstsein hat, dass das etwas ganz Besonderes ist. Einfach spielen und sich dabei gut zu fühlen, das macht ja niemand mehr. Kinder tun das. Und Affen. Bei Erwachsenen kostet das Überwindung. Und es braucht Vertrauen.
Haben Sie noch Angst davor, sich lächerlich zu machen?
Nein, keine Angst. Im Grunde ist ja auch niemand lächerlich.
An einer Stelle im Stück, nachdem Prospero Miranda und Ferdinand seinen Zauber vorgeführt hat, ist die Show sprichwörtlich aus. Da heißt es sehr bekannt: „Wir sind aus demselben Stoff, aus dem auch Träume gemacht werden. Und unser kleines Leben ist vom Schlaf umzingelt.“ Alle Wolkenkratzer, Prunkpaläste und ehrwürdigen Tempel lösen sich auf, selbst der ganze Globus, wie die Geister aus Prosperos Vorstellung. Was bleibt von uns am Ende?
Da will ich nicht groß poetisch sein: Ruhe. (Überlegt lange) Es gibt da einen Satz von Beckett aus Warten auf Godot: „Sie gebären rittlings über dem Grabe, der Tag erglänzt einen Augenblick und dann von neuem die Nacht.“ Das ist seine Lebensbeschreibung. Ein unheimlich poetischer Satz, zu dem will ich gar nicht mehr sagen.
Also lieber doch poetisch zum Ende?
Ja, doch.

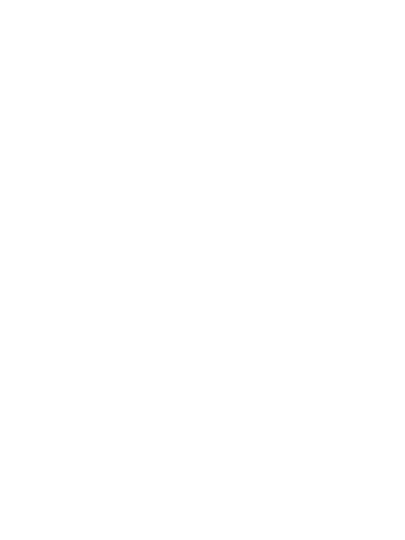
Kosminski inszeniert Shakespeares letztes Stück als Märchenspiel und bittersüße Reflexion über das Theater und seine Mittel. Neu ist das nicht, aber unterhaltsam. … Dieser Stuttgarter "Sturm" ist ein luftiges, leichtfüßiges, durch und durch verspieltes Theatervergnügen, das Freude an schlichten, aber wirkungsvollen Effekten hat.
… Camille Dombrowsky als Miranda …, jung, mädchenhaft, mitreißend, kann lachen, schmollen, über die Bühne fegen, aber vor allem kann sie auch wunderbar singen. Hans Platzgumer hat für ihren betörenden Sopran und den Bariton von David Krahls König Alonso einige Barockstücke arrangiert, etwa von Henry Purcell und John Dowland.
[Das Existentielle] beherrscht kaum ein Schauspieler so wie André Jung, der hoffentlich nicht nur für dieses eine Engagement in Stuttgart gastiert: seine Figur, diesen scheinbar kühl kalkulierenden Macht-menschen mit einem Blick, einer Geste ins Bodenlose stürzen zu lassen.
Mehr nur als Mahner und Helfer ist in diesem Ränkespiel Sylvana Krappatschs Ariel, der sich seine Freiheiten nimmt, Marotten seines Herrn spöttisch kommentiert, streng auf seine Rechte als Arbeitnehmer pocht – „Ich habe Pause!“ –, vor Wut tatsächlich schier kocht und dem es aus seinen Kleidern heraus raucht, als Prospero immer noch eine und noch eine Aufgabe für ihn hat, denn eigentlich will er frei sein. Sie sind ein derart eingespieltes Team, dass sie wie Eltern am Rand dastehend wirken, beglückt darüber, dass ihre Künste gelingen, Miranda und Ferdinand ineinander verliebt zu machen. Doch dann, als Prospero Ariel wie versprochen entlassen hat, die Bühne leer und öd ist, er und Caliban allein im Dunkel über die Bühne schlurfen, sieht man förmlich, wie er denkt, dass die neue Freiheit ziemlich öd ist. …
Dass … Shakespeares Unterhaltungskünste auch vierhundert Jahre nach der Erstaufführung noch hervorragend funktionieren, das zu zeigen ist dem Regisseur und dem großartigen Ensemble hervorragend gelungen. Ebenso, wie zu demonstrieren, was das Theater im besten Falle sein kann: Magie.
Zur vollständigen Kritik
Es ist eine gute Idee, Prospero und Ariel als altes Paar auftreten zu lassen, das sich bei gegenseitiger Sympathie ein wenig auseinandergelebt hat. …
… Camille Dombrowsky ist die Entdeckung dieses Abends. Ihre Miranda scheint per natürlicher Begabung alle amourösen Tricks des Anschmachtens schon zu kennen, und nebenbei singt sie derart betörend Vivaldi, dass der eh schon märchenhafte Gestus der Inszenierung nun vollends die Oberhand gewinnt.
Man kann diesen Zaubergarten auch für harmlos halten, aber die Entscheidung der Regie, einmal an den Nullpunkt zurückzugehen und sich nur auf die Schauspieler zu konzentrieren, hat auch Vorteile. Man sieht nämlich, dass das, was Prospero angeblich per Fingerschnippen und auf einer Schaukel sitzend an Wahnmomenten für andere inszeniert, in Wahrheit die kunstvolle Arbeit seiner Schauspielkollegen ist.
Burkhard Kosminski hat das Stück radikal entschlackt, die Trunkenbold Trinculo und Stephano auf ein stringentes Format gebracht …
Der wahre Zauber geht von André Jung aus, der auf Rache verzichtet an denen, die ihn einst entmachtet haben. …
Reines Schauspielertheater kann ziemlich gut sein …
Zur vollständigen Kritik
Schauspielerisch gibt es … Glanzlichter. André Jungs Prospero ist der Regisseur dieses Inselreichs, der aus dem Textbuch vorliest und mit seiner Truppe einen fein orchestrierten, künstlichen Stimmen-Sturm lärmen lässt, Donnerblech inklusive. Jungs Prospero ist eine schillernde Figur: mürrischer Magier, befehlsgewohnter Inseltyrann, lässiger Strippenzieher, großherziger Melancholiker – Jung packt das alles mit rein. Sein Prospero kann per Fingerzeig Klänge herbeizaubern, kann Mitmenschen mit einer winzigen Wink an und ausknipsen.
Sylvana Krappatsch wertet ihren Ariel auf – als zappligen, aufmüpfigen Luftgeist, der mit Prospero zuweilen in schwindelnder Höhe auf einer Schaukel sitzt und zufrieden das Inszenierte von oben betrachtet. Der einzige echte Insulaner, Caliban, ist bei Evgenia Dodina ein humpelndes, krächzendes, „missgestaltetes“ B-Movie-Ungetüm, das mit dem abgedrehten Komikduo Trinculo und Stephano vergeblich den Aufstand wider den Kolonialherrn Prospero probt.
Zur vollständigen Kritik
… darstellerische Gesamtleistung. Angefangen bei Gaststar André Jung, 1981 und 2002 zum Schauspieler des Jahres gewählt, dem die Rolle des Prospero als erniedrigtem, gleichwohl nie primitivem Rache-Helden, der die Handlung wie ein Bühnenautor von außen steuert, auf den Leib geschneidert ist, bis zur hervorragenden Leistung der Ensemble-Mitglieder. Um nur einige zu nennen: Camille Dombrowsky, flapsig-modern, gerade heraus und auch gesanglich überzeugend, Sylvana Krappatsch als koboldhafter Luftgeist, der auch schon mal vor Empörung aus allen Gesichtsöffnungen raucht wie ein kleiner Drache. Da ist Evgenia Dodina in der Rolle des monströsen, vierbeinigen Inselsklaven Caliban, der in Aussehen und Hinterhältigkeit an Gollum aus „Herr der Ringe“ erinnert. Und nicht zuletzt das Trio David Krahl, Felix Strobel (als großartiges Nervenbündel Sebastian) und Reinhard Mahlberg ...
Bei aller Kurzweiligkeit verhandelt Kosminskis Inszenierung, die auch in Kostümen (Ute Lindenberg) und musikalisch (Hans Platzgumer) überzeugen kann, – letzteres vor allem mit Henry Purcells Arie „What power art thou“ – alle großen Themen dieses letzten Dramas William Shakespeares, das 1611 erstmals zur Aufführung gelangte: Magie, Verrat, Rache, Macht, Liebe und Vergebung.
… Mut zur Lücke und Konzentration auf das Wesentliche, gepaart mit sehr hoher Schauspielleistung, dürften … den Ausschlag gegeben haben für den minutenlangen Schlussapplaus und jede Menge „Bravo“-Rufe.
Zur vollständigen Kritik
Wie Camille Dombrowskys Miranda steht auch Sylvana Krappatschs gewitzter, aber nicht possierlicher Ariel Prospero von vornherein mit kühler Skepsis gegenüber. Sie durchschauen ihn, es hilft ihnen bloß nichts.
Zur vollständigen Kritik
Krappatschs Dialoge mit André Jung als stillem Prospero klingen sehr spontan, die Ironie ist fein dosiert, das Timing subtil. Das mag an der lakonischen, geerdeten Übersetzung von Jens Roselt liegen; aber auch Prosperos Dialoge mit seiner Tochter Miranda spielen federleicht mit Blicken, Pausen und Pointen. Das erlebnishungrige Mädchen (die lebhafte Camille Dombrowsky) stürzt sich geradezu auf den Königssohn Ferdinand, der nach dem Sturm über die Insel irrt. Marco Massafra setzt der Göre einen korrekten, leicht verpeilten Gutmenschen entgegen. …
Die Theatermetapher prägt den Abend. Florian Etti hat eine Bühne auf der Bühne gebaut, die mit wehenden roten Vorhängen um sich selbst kreiselt. Ute Lindenberg mischt alte und moderne Kostüme. Einmal raucht Ariel buchstäblich die Wut aus den Kleidern. …
»Der Sturm« feiert bei Kosminski die Magie des Theaters und die Kunst, gerade die vielen selbstreferenziellen Anspielungen Shakespeares klingen deutlich durch in dieser Inszenierung. … [Es gibt] schöne Musik: Camille Dombrowsky und David Krahl singen zarte Renaissance-Arien, zwischendurch knallt Chatschaturjans Säbeltanz herein. …
Wie sehr »Der Sturm« ein Abschiedswerk ist, dafür steht André Jung als Prospero: ein zerstreuter, ein wenig trauriger Poet, der das Textbuch der Souffleuse ausleiht und die jüngeren Mitspieler doch mit Übersicht herumdirigiert. Einer, der den müßigen Ehrgeiz der Menschen mit Milde betrachtet. Politik ist hier ein Spiel auf dem Theater, die Mächtigen werden zu taumelnden Figuren, die nur ein kluger Regisseur zum guten Ende bringen kann. Der alte weis(s)e Mann nimmt Abschied, auch deshalb passt das Werk so gut in unsere Zeit und bietet so viel Stoff zum Nachdenken.
Zur vollständigen Kritik
Kosminski unterstreicht in der Inszenierung des stark gekürzten Stücks dessen märchenhafte Elemente, aber die Sprache von Jens Roselts Übersetzung kommt ziemlich poesiefrei daher. …
… die junge Camille Dombrowsky beweist als Prosperos naive Tochter Miranda einmal mehr, dass sie ganz toll singen kann.
Schließlich findet die Inszenierung das richtige Maß an Komik. Sie gibt weder der Versuchung zum Klamauk nach, noch der Verlockung, die Clownsszenen zwischen Trinculo (Sven Prietz) und Stephano (Christiane Roßbach) an prätentiösen Tiefsinn zu verraten. Fast wäre man geneigt, den Abend mit ... „nicht zu toppen“ zu bewerten, wäre da nicht, alas, die Erinnerung an die tatsächlich unüberbietbare Fassung von Peter Brook. Sie hatte unter anderem den unermesslichen Vorteil, von Shakespeare und nicht von Jens Roselt zu stammen.
Zur vollständigen Kritik
… Evgenia Dodina spielt [Caliban] hochvirtuos mit frustrierter Machtgier.
Das Zentrum des Abends ist aber André Jung: Trotz Frisur eines gealterten Schlagerfuzzis verleiht er seinem Prospero eine schwermütige Würde und zeigt doch einen herrschsüchtigen alten Mann, der sich alle unterwirft.
Zur vollständigen Kritik
... In Kosminskis Inszenierung verändert und verschiebt sich die offene Bühne in permanenter Weise. Witz, Humor und Ironie kommen nie zu kurz – auch dann nicht, wenn Prospero Rache an seinem von Reinhard Mahlberg virtuos gemimten Bruder Antonio nimmt.
… An Kunstgriffen mangelt es dieser Inszenierung nicht, die ansonsten mit recht sparsamen Mitteln auskommt. … Shakespeares Verse werden sehr lebendig umgesetzt – vor allem bei der symbolkräftigen Figur Calibans, dem Sohn der Hexe Sycorax und des Teufels. Dazu passt recht gut die eindringliche Musik von Hans Platzgumer. …
… Burkhard C. Kosminski glückt hier … eine Inszenierung, die einen großen philosophischen Bogen spannt, die visuelles Geschehen mit gedanklicher Tiefe verbindet. Vor allem ist das Publikum stets gebannt, nie gelangweilt. ... „Bravo“-Rufe, viel Applaus für das gesamte Team.
Zur vollständigen Kritik